Indem Sie zulassen, dass wir Ihre Besuche auf dieser Webseite anonymisiert mitzählen, helfen Sie uns das Angebot für Nutzerinnen und Nutzer zu optimieren. Dafür verwenden wir Cookies. Die erfassten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Mehr Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Wer unsere Dienstleister sind, können Sie im Impressum unter folgendem Link nachlesen: Impressum.
Bislang war nur wenig über die genetischen Ursachen der Depression bekannt. Nun wurden 30 neue Gene entdeckt, die zur Entwicklung einer Depression beitragen. Mit diesem Wissen können die Ursachen der Erkrankung weiter erforscht und neue Therapien entwickelt werden.

Schätzungen zufolge leiden in Deutschland über 4 Millionen Menschen an einer Depression.
maxkegfire/iStock
Zehn Jahre lang haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammengearbeitet, um die genetischen Ursachen von Depressionen zu erforschen. Viele äußere Faktoren tragen zu dieser Erkrankung bei. Aber dass es auch einen erblichen Zusammenhang gibt, ist für die Experten offenkundig. So gibt es beispielsweise Familien, in denen schwere Depressionen gehäuft vorkommen. Doch dieser erbliche Zusammenhang lässt sich auf der molekularen Ebene nur mit großem Aufwand nachweisen. Denn an einer Depression sind viele Prozesse im Gehirn beteiligt – der Beitrag einzelner Gene ist gering. Deshalb müssen die Wissenschaftler eine möglichst große Stichprobe an Betroffenen und Gesunden untersuchen, um die einzelnen beteiligten Gene sicher nachweisen zu können. „Das funktioniert nur in einer groß angelegten internationalen Studie“, erklärt Professor Markus Nöthen, Direktor des Instituts für Humangenetik am Universitätsklinikum Bonn.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass weltweit etwa 322 Millionen Menschen von Depressionen betroffen sind. Das sind mehr als 4,4 Prozent der Weltbevölkerung und 18 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Für Deutschland schätzt die WHO die Zahl der Menschen mit Depressionen auf über vier Millionen.
Depressionen beeinträchtigen sowohl die Lebensqualität als auch die soziale, körperliche und geistige Leistungsfähigkeit oftmals in einer fundamentaleren Weise als chronische körperliche Erkrankungen.
Das internationale Konsortium hat die genetischen Daten von mehr als 135.000 Betroffenen und 344.000 Kontrollpersonen ausgewertet. Damit ist die Studie die größte bislang durchgeführte Untersuchung zu den molekularen Ursachen der Depression. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Universitätsklinikum Bonn trugen mit der Untersuchung des Erbguts von fast 600 Patientinnen und Patienten sowie rund 1.000 Kontrollpersonen zur Studie bei. Aus Deutschland waren neben dem Universitätsklinikum Bonn unter anderem auch das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, die Universitätsmedizin Greifswald sowie die Universitäten Münster und München an der Studie beteiligt.
Tatsächlich konnten die Forscher 44 Stellen auf dem Genom, sogenannte Loci, identifizieren, die mit schweren Depressionen in Verbindung stehen. Von diesen 44 Loci waren 14 bereits durch vorangegangene Untersuchungen bekannt, 30 Loci waren bislang unbekannt. „Jedes zusätzlich identifizierte Gen, von dem wir nun wissen, dass es mit der schweren Depression zusammenhängt, trägt in Zukunft zur Aufklärung der Ursachen und zugrunde liegenden biologischen Mechanismen dieser weit verbreiteten Erkrankung bei“, erklärt Nöthen. Eine wichtige Erkenntnis aus der Studie ist auch, dass schwere Depressionen sich auf genetischer Ebene nicht prinzipiell von weniger schweren Depressionen und Depressivität, also einer Verstimmtheit, wie sie viele Menschen im Laufe ihres Lebens erleben, unterscheiden. Zudem zeigen die Ergebnisse, dass alle Menschen in ihrem Erbgut mehr oder weniger genetische Risikovarianten für Depressionen haben. Äußere Bedingungen können dazu beitragen, ob die Krankheit ausbricht oder nicht. Die Ergebnisse der Studie bieten nun die Grundlage für eine Vielzahl von Folgeuntersuchungen. Zum einen wird es darum gehen, die genetischen Grundlagen für Depressionen noch besser zu verstehen. Zum anderen kann mit diesem Wissen die Wirksamkeit von Therapien weiter verbessert werden. Denn die vorhandenen Medikamente helfen nicht bei allen Betroffenen.
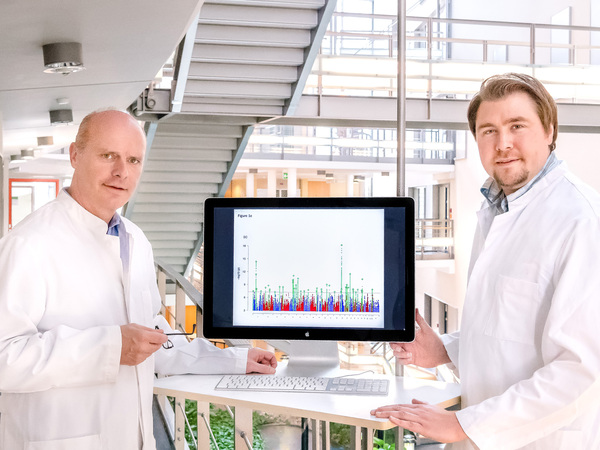
Professor Markus Nöthen (links) und sein Kollege Dr. Andreas Forstner mit einem Manhattan-Diagramm: Die Stellen im menschlichen Genom, die mit einer schweren Depression in Verbindung stehen, ragen als „Hochhäuser“ aus dem Hintergrundrauschen heraus.
Andreas Stein/Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Bonn
„Zukünftig wird es nun darum gehen, zum Beispiel Gruppen von Patientinnen und Patienten zu identifizieren, deren psychische Erkrankung ähnliche Ursachen hat. Wir suchen also Betroffene, bei denen etwa die beteiligten Gene oder andere Faktoren sehr ähnlich sind“, erklärt Nöthen. Dazu werden von den Forscherinnen und Forschern neben genetischen Befunden und äußeren Bedingungen auch weitere Daten erhoben. „Wir suchen beispielsweise nach epigenetischen Faktoren, die als Mittler zwischen Umwelt und Genetik fungieren. Und wir dokumentieren spezifische Gehirnfunktionen, die man mit Bildgebungstechniken sichtbar machen kann. Das sinnvolle Zusammenführen dieser verschiedenen Datenebenen ist eine große Herausforderung für die zukünftige Forschung“, beschreibt Nöthen die Arbeit seines Forschungskonsortiums „IntegraMent“. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen entwickelt er zurzeit sowohl experimentelle als auch mathematische Modelle für verschiedene Krankheitsprozesse der Psyche. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert diese Entwicklung.
Prof. Dr. Markus M. Nöthen
Institut für Humangenetik
Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Straße 25
53127 Bonn
Tel.: 0228 28751101
E-Mail: markus.noethen@ukb.uni-bonn.de